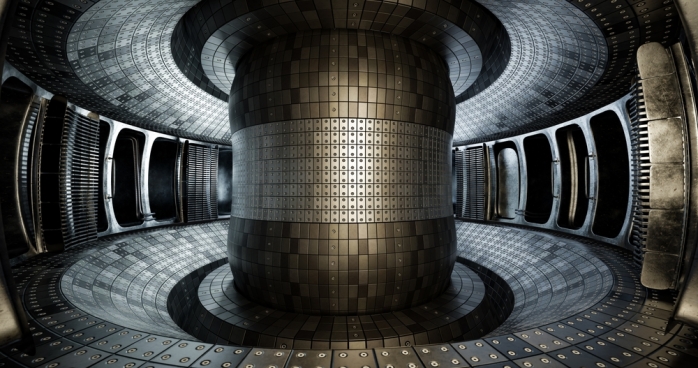Die jahrelange Eintönigkeit der deutschen Massenberichterstattung lässt diesen Imageverlust auch in der deutschen Gesellschaft um sich greifen und schmälert die Sympathien gegenüber Ungarn. Das Ungarische Institut in Bayern wünscht aus Anlass seines sechzigjährigen Bestehens und der ebenfalls 2022 anstehenden dreißigsten Jahrestages des deutsch-ungarischen Vertrages mit wissenschaftlichen und kulturellen Angeboten daran zu erinnern, dass es Zeit ist für eine Selbstbesinnung – für eine Selbstprüfung auf deutscher wie ungarischer Seite.
Was können die Ungarn tun, um die Gestalter des ungarisch–deutschen Verhältnisses zur Rückkehr auf den Weg des vernünftigen Dialogs zu bewegen? Zuerst müssen sie mindestens zwei der wichtigen Ursachen für die deutsch–ungarische Entfremdung erschließen.
1. Die Auseinanderentwicklung des ungarischen und des deutschen Nationalbewusstseins
Zu den Anfängen des Systemwandels lebte der seit dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts traditionelle innerungarische Kulturkampf auf. Er bettete eine linksliberale und eine rechtskonservative Strömung auch in das konfliktbeladene jüdisch-christliche Verhältnis mit jeweils ausgeprägten Identitätsmerkmalen ein. Aus den entsprechenden Fremd- und Selbstzuordnungen entstanden in den frühen 1990-er Jahren zwei Ausschließlichkeitsansprüche: Nach der Linken könne national nicht auch liberal, nach der Rechten liberal nicht auch national sein.
Die 1990 nach vier Jahrzehnten erste frei gewählte Regierung unter József Antall trat ihr Amt mit der übergreifenden Zielsetzung christdemokratischen Zuschnitts an, von den historischen Mustern ungarischer Politik-, Gesellschafts- und Kulturkonzepte den an individueller Freiheit und nationaler Souveränität orientierten Nationalliberalismus einzubürgern und zu popularisieren. Diesem rechtskonservativen Wunschprogramm ist der Liberalismus im Verlauf der im Kulturkampf ideologisch schwer belasteten innenpolitischen Auseinandersetzungen nach und nach abhandengekommen. Ein entscheidender Beschleunigungsfaktor war dabei, dass im jungen ungarischen Mehrparteiensystem die Linke einen Alleinvertretungsanspruch auf den Liberalismus und die Demokratie anmeldete. Zugleich lehnte sie den nationalen Gedanken nicht nur für sich selbst ab, sondern warf dessen Verfechtern Rückwärtsgewandtheit vor und sprach ihnen die Demokratietauglichkeit ab. Im Gegenzug warf ihr die Rechte vor, anational, ja sogar antinational zu sein. Die Medien und die kulturelle sowie politische Öffentlichkeit in Deutschland mischten sich von Anbeginn einseitig in den innerungarischen Kulturkampf ein: sie stellten sich auf die Seite des nationskritischen Liberalismus – wo sie auch heute stehen, mit einer seither angewachsenen Entschlossenheit.
Dieser deutsche Eingriff hat sich ursprünglich mit einem zusammengesetzten, dennoch kurzen ungarischen Satz rechtfertigt: mit der 1990 formulierten und 1992 wiederholten Erklärung von József Antall, nach der er, Antall, „der Ministerpräsident von zehn Millionen ungarischen Staatsbürgern, aber in der Seele und den Empfindungen der Ministerpräsident von fünfzehn Millionen Ungarn zu sein wünsche”. Schon damals zeigte sich eine Besonderheit der bald vierten öffentlichen Gewalt, der Medien: die bewusste oder aus fachlicher Unbildung begangene Verdrehung oder Verfälschung von Tatsachen. In den ersten Jahren des ungarischen Systemwandels zitierte die tonangebende Presse in Deutschland Antalls Äußerung in der Regel als der Ministerpräsident von fünfzehn Millionen Ungarn, also ohne das Beiwort in der Seele, und für die lückenhaft informierten Leser fügte sie hinzu, dass Ungarn nur zehn Millionen Einwohner habe. So begründete sich im Ausland – mit deutscher Vermittlung – der Vorwurf des großungarischen Nationalismus und Antisemitismus, an dem bald auch der Stempel der Roma- und Muslimfeindlichkeit klebte.
Tieferen Nährstoff erhielt dieser frühe deutsch–ungarische Gegensatz aus dem Umstand, dass die beiden Staaten gleichzeitig das Tor der neuen Freiheit erreichten, die ungarische und die deutsche Nation aber von dort aus in jeweils andere Richtung voranschritt. Die beiden Verlierer des Zweiten Weltkrieges hatten bis dahin parallel ihr eigenes Nationalbewusstsein unterdrückt. In Ungarn lebte aber 1990 der kulturell-sprachlich eingewurzelte nationale Patriotismus auf – der nicht zu verwechseln ist mit der offensiven und ausgrenzenden Leidenschaft zur Verherrlichung der Heimat. In Deutschland hingegen ist das Gegenmittel zu dem im Nationalsozialismus missbrauchten Nationalgefühl, der aus der Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland in den 1970-er Jahren abgeleitete Verfassungspatriotismus nach der Erlangung der vollen Souveränität der wiedervereinigten beiden Staaten nicht zu neuer Kraft gelangt, sondern ins Stocken geraten und begann bald zu schwächeln. Denn das mit seiner Wiedervereinigung in eine Großmachtrolle zurückkehrte Deutschland sah sich sowohl innen- als auch außenpolitisch von der entschiedenen Erwartung herausgefordert, den wahrhaftigen oder vermeintlichen deutschen Nationalismus in Schach zu halten und möglichst aufzulösen. Der unablässige Nachweis der eigenen politisch-moralischen Reinheit drängte selbst den Verfassungspatriotismus in den Hintergrund, an dessen Stelle mit zunehmendem Einfluss das Ideal des über die Nationen und Nationalstaaten zu erhebenden Europa trat.
Heutzutage bedeutet mehr Europa auf Deutsch: weniger deutsche Nation. Dieses Programm verbirgt sich im politischen Mehrheitswunsch innerhalb der Europäischen Union, der die Anforderung der mitgliedstaatlichen Selbstbestimmung als „Souveränismus“ beschimpft, den betreffenden Parteifamilien und deren Wählern in der schrofferen Wortwahl nationalistische Europafeindlichkeit vorwirft. Die ungarische Regierung ist solcherart leidtragendes Subjekt einer Umdeutung der traditionellen politik- und rechtswissenschaftlichen Auffassung, einer geistigen Aktion, die den Gedanken des auf dem Prinzip der Einheit in der Vielfalt beruhenden europäischen Bündnisses aus seinem ursprünglichen Wesen gleichsam herausbricht.
2. Das Höherwertigkeitsbewusstsein der liberalen Demokratie
Es ist ein schwerwiegender Umstand, dass die kritische Betrachtung der deutschen Nation mit einer grenzüberschreitenden ideologischen Umgestaltung Hand in Hand ging. Um 1990 wurde der Kommunismus inmitten breiter Zustimmung und Zuversicht vom Liberalismus abgelöst, der im Laufe der nächsten Jahre, wohlfeil über den übrigen demokratischen Parteien schwebend, einen international ausgreifenden Machtanspruch entwickelte. Die heutzutage im In- und Ausland, landauf-landab „liberale Demokratie“ genannte politische Strömung ist in ihrem deutschen Rollenbild Fahnenträgerin des progressiven Europäertums, somit des nationskritischen Weltbildes.
Die in ungarischer Richtung besondere Empfindlichkeit der deutschen Liberaldemokratie begründete seit den frühen 1990-es Jahren die aus der internationalen Publizistik des Budapester Kulturkampfes entlehnte Meinung, nach der in Ungarn „liberal“ für die ungarische Rechte auch „jüdisch“ bezeichne, und „liberal“ eigentlich ein Schimpfwort sei, das einen kodierten Antisemitismus ausdrücke. Im Zeichen dieser Interpretation spürten deutschsprachige Presseorgane bereits vor Beendigung der ungarischen Parlamentswahlen vom 11.–25. April 2010 den „Vorgeschmack des Kulturkampfes”, sahen sogar den „Geist des Neofaschismus” aufsteigen, in Ungarn, wo „sich Juden wieder fürchten“ müssten. Solche Alarmsignale verdichteten sich zum Rundumvorwurf des fremdenfeindlichen, bald des diktatorischen Autoritarismus, nachdem sich die Kräfteverhältnisse im Budapester Parlament zu Lasten der von 2002 bis 2010 regierenden Linksliberalen veränderten.
Das deutsche Lager der Liberaldemokratie lehnt die Tätigkeit der ungarischen Regierungen seit 2010 in erhöhtem Maß ab, und missbilligt, wie es ihm die „weitreichende Liberalität im Westen und vor allem in Deutschland” als gerechtfertigt vorgibt, das ungarische „Gesellschaftsbild”. Mit der Anklage gegen den einstigen Waffenbruder im Zweiten Weltkrieg kann sich Deutschland von seiner neueren Nationalgeschichte abgrenzen, also jenes politisch-moralisches Gutmenschentum bezeugen, dessen Gebot das wiedervereinigte Land getreu zu folgen pflegt. Es handelt sich um eine Art Warenbündelung bei der Kritikflut, deren politische und gesellschaftliche Wirksamkeit die Rede von Viktor Orbán im siebenbürgischen Tusványos am 26. Juli 2014 weiter erhöhte. Darin kam von den eingangs erwähnten beiden Sätzen der zweite vor, und zwar mit dem im Ausland umgehend berüchtigten Standpunkt, dass „der neue Staat, den wir in Ungarn bauen, ein illiberaler Staat, ein nicht liberaler Staat ist. Er leugnet nicht die grundlegenden Werte des Liberalismus wie die Freiheit – und ich könnte noch einige erwähnen –, aber er macht diese Ideologie nicht zum zentralen Element der Staatsorganisierung, sondern enthält eine davon abweichende eigenartige, nationale Annäherung“. Die deutschen Blätter und Portale haben, welcher ideologischer Ausrichtung sie auch sein mochten, aus diesem ungarischen „Illiberalismus” so gut wie einstimmig die Absicht und Praxis der Einschränkung der staatsbürgerlichen Menschen- und Minderheitenrechte, ja sogar der Aufhebung der Demokratie selbst herausgelesen, und vermitteln diese Auslegung seither unermüdlich. Bislang hat sich kein maßgebliches Forum bereitgefunden, den Illiberalismus Orbánscher Prägung mit dem innen- und wirtschaftspolitisch motivierten Gegensatz zwischen zwei Polen zu erklären: einerseits dem individualistischen und am materiellen Nutzen orientierten Liberalismus, andererseits dem nationalen Weltbild, das auf das kulturell unterbaute Gemeinschaftsprinzip aufbaut. Die deutschen Kritiker haben auch nicht bedacht, dass der noch so unglücklich verwendete Begriff selbst als Reizwort nicht eine Gegnerschaft zum Liberalismus, sondern Nicht-Liberalismus bedeutet.
Wie die Verlautbarung von József Antall aus den Jahren 1990 und 1992, so verbreitete sich auch Viktor Orbáns staatsorganisatorischer Abriss aus dem Jahr 2014 nicht in uneingeschränkter inhaltlicher Authentizität in der deutschen politischen Öffentlichkeit: In beiden Fällen wurde jenes Wort beziehungsweise Textelement wegredigiert, deren genauen Bezeichnungen über die wahre Absicht des Autors des womöglich missverständlichen und missdeutbaren Gedankens aufgeklärt hätte. Die Verletzung einer goldenen Regel des Journalismus diente der nachträglichen Bestätigung eines Vorurteils: bei Antall jenes des ungarischen Revisionismus, bei Orbán jenes der ungarischen Diktatur. Erst die letztere Brandmarkung veranschaulicht die ganze Tragweite des für die politische und gesellschaftliche Öffentlichkeit im heutigen Deutschland charakteristischen Ungarn-Bildes, da sie die Kulturkritik mit Systemkritik verschmilzt: sie lässt die nationalistische-antisemitische Fremdenfeindlichkeit und die menschenrechtliche Freiheitsfeindlichkeit als Bestandteile der gleichen Verirrung erscheinen.
3. Die Entschlossenheit der Gleichrangigkeit
Wir leben in einer Zeit der Begriffs- und Identitätsverwirrungen. Liberale Demokraten erkennen in ihrem Höherwertigkeitsbewusstsein nur eine Meinung als demokratisch an, versinken so im Antiliberalismus. Der europäische Föderalismus will sich zur Gleichstimmigkeit verengen. Die nationale Verpflichtung wird zum Nationalismus abgewertet, obwohl sie weder angreift noch zerstört, sondern konstruktiven Schutz bietet.
Wenn wir die Chancen der Entschärfung des ungarisch–deutschen Konflikts abwägen – Heilungsmittel gegen die Entfremdung suchen –, sollte sich zuallererst die Klärung des Schlüsselbegriffs anbieten, um zu ihrem ursprünglichen Sinn zurückzukehren, aufgrund dessen der sinnvolle Dialog vielleicht neu beginnen kann. Währenddessen ist es hilfreich, zu bedenken, dass die Trennungslinie im ungarisch–deutschen Verhältnis, aber auch in den bedeutsamen Beziehungsgeflechten der Europäischen Union, nicht zwischen Anhängern von Demokratie und Antidemokratie, sondern zwischen jenen eines homogenisierungsbestrebten und eines auch in seiner Vielfalt einheitlichen Europa verläuft.
Die Auffassung, wonach das liberale und das nationale Interesse einander widersprechen, will im ideologischen Wettstreit nur eines der Weltbilder als Sieger anerkennen. Ist einmal die Versuchung des einen oder des anderen Ausschließlichkeitsanspruchs abgelegt, könnte die gegenseitige Befriedung der Nation und des Liberalismus beginnen. Die offene Gesprächsbeziehung ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass sich endlich herausstellt: es ist ein Missverständnis oder eine Fehldeutung, dass der ungarische „Illiberalismus“ die Freiheitsrechte antidemokratisch einschränke oder gar diktatorisch beseitige. Schallend zutreffend ist hingegen der ergänzende Hinweis, dass die als ungarischer „Illiberalismus“ verschriene politische Idee geradewegs auf urliberale Weise an der Berechtigung zum freien Willen in den Debatten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union festhält. Nur diese Freiwilligkeit veredelt den Liberalismus zur Idee der Freiheit, Souveränität und Gleichrangigkeit – zu jener Kraft, die eine pluralistische Demokratie über Parteien hinweg benötigt.
Diese Begrifflichkeit, die europaweit heftigen Missmut ausgelöst hat, bemühte sich im vergangenen halben Jahrzehnt um ihre Ausdehnung im christdemokratischen Sinn, wobei sie jedenfalls ihren höchsten Orientierungswert beibehielt und zeitweise heraushob, nämlich die Herrschaft des Rechts, das auch die Regierungsarbeit in die Schranken weist. Aus diesem Blickwinkel wäre „Illiberalismus“ sogar aus dem ungarischen politischen Wortschatz zu streichen – zumal er kein wesensbestimmendes Element der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung Ungarns ist.
Das Mathias Corvinus Collegium, das Ungarisch–Deutsche Institut für Europäische Zusammenarbeit und das Rubicon Institut haben am 28. April 2022 in Budapest mit dem Titel „Ungarisches Selbstbild – im deutschen Spiegel“ eine inhaltsreiche Diskussion über obige Gedanken und sachlich angrenzende Fragenkreise vor vollem Haus veranstaltet. Überraschung löste im Publikum und teilweise auf der Bühne die zeitgeschichtliche Erklärung für die Hindernisse der bilateralen Verständigung und des gegenseitigen Verständnisses aus, nämlich die Skizze über die ungarische und die deutsche Anschauung vornehmlich über die Nation, die nicht nur nicht identisch sind, sondern in den Jahrzehnten seit den Systemumbrüchen in Deutschland und Ungarn sich immer mehr voneinander entfernt haben. Beim Podiumsgespräch war auch das psychologische Moment der Selbstkritik zu spüren, an deren Schauplatz man die eigenen Probleme ja am besten kennt und sie mitunter vergrößert, vor allem dann, wenn über die auswärtigen Verhältnisse oberflächliche und ungeprüfte Kenntnisse vorliegen. In ungarisch–deutschen Angelegenheiten ist nicht nur aus einem Beispiel ersichtlich, dass berechtigte oder übermäßige Selbstkritik ungarische Foren manifestieren, während die deutschen ihre eigene Wahrheit in der Regel aus lückenlos fester Überzeugung beteuern.
Der abendfüllende Gedankenaustausch handelte von der Beziehung zwischen ungleichen Trägern des internationalen Kontaktsystems sowie vom Bild, das sie jeweils voneinander pflegen. Der Zauber der Örtlichkeit ließ die Gestalt und die Verantwortung des stärkeren europäischen Akteurs für den gegenwärtigen Zustand der bilateralen Beziehung streckenweise erblassen. Gerade deswegen drängte sich als Lehre auf, dass es nicht ratsam ist, die Vorgänge in Deutschland zu unterschätzen. Es ist ebenso wenig zielführend, die ideologischen Ränder – aus welcher Voreingenommenheit auch immer – in den Mittelpunkt zu rücken. Die Radikalitäten gehören zum Gesamtbild, sie sind aber weder hier noch dort maßgeblich. Es zeugte jedenfalls von überzogener Gutgläubigkeit, wenn geopfert werden würde, was auch der schwächeren Seite zusteht: die Vermutung der politisch-moralischen Reinheit auch im Falle abweichender oder gegensätzlicher Meinung. Und wer sich dieses Vertrauensvorschusses in der Praxis würdig erweist, der sollte den Mut aufbringen, auch gegenüber Liberaldemokraten gleichrangig zu sein.